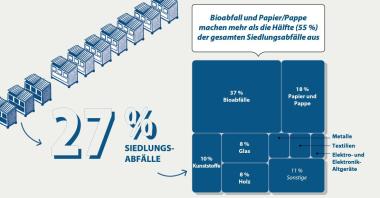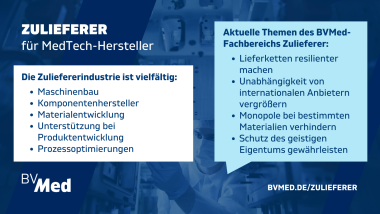ICAC Plenary direkt vor der Bremer Baumwolltagung
Das International Cotton Advisory Committee (ICAC) wird seine 83. Plenarsitzung am 23.-–24. März 2026 im Parlamentsgebäude in Bremen veranstalten. Die Tagung findet direkt vor der 38. International Cotton Conference Bremen (25.-27. März 2026) statt und markiert eine historische Premiere: Erstmals wird das ICAC-Plenum in enger Zusammenarbeit mit der Bremer Baumwollbörse und dem Faserinstitut Bremen e.V. (FIBRE) ausgerichtet.
Das ICAC ist ein Verband auf Regierungsebene mit Sitz in Washington, DC. Die Mitgliederländer produzieren, verarbeiten oder handeln Baumwolle. Das ICAC-Plenum steht unter dem Motto „Uniting the Cotton and Textiles Value Chain for a Sustainable Future“ („Die Baumwoll- und Textilwertschöpfungskette für eine nachhaltige Zukunft vereinen“) und unterstreicht das Engagement der Organisation, ihre Mitgliedsregierungen zu unterstützen sowie Nachhaltigkeit, Innovation und wirtschaftlichen Wohlstand entlang der gesamten Baumwolltextilwertschöpfungskette – vom Saatgut bis zum Einzelhandel – voranzutreiben.
Fritz Grobien, Präsident der Bremer Baumwollbörse, erklärt: „Wir freuen uns sehr, das ICAC als Organisation auf Regierungsebene in Bremen willkommen zu heißen. Das ICAC, die Bremer Baumwollbörse und das Faserinstitut Bremen sind drei Institutionen der globalen Baumwollindustrie, die das Thema Baumwolle auf unterschiedliche Weise und auf höchstem Niveau vertreten. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass das ICAC-Plenum als wertvoller Beitrag am Beginn unserer eigenen Konferenz stattfindet.“
„Die Ausrichtung unserer 83. Plenarsitzung im Bremer Parlamentsgebäude markiert eine erstmalige, historische Zusammenarbeit zwischen dem ICAC und der Bremer Baumwollbörse“, sagte Eric Trachtenberg, Executive Director des ICAC. „Seit Jahrzehnten arbeiten unsere Organisationen zusammen, um die globale Baumwoll- und Textilindustrie zu stärken, und diese gemeinsame Programmwoche verspricht ein absolutes Highlight für Fachleute aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette zu werden. Wir freuen uns sehr darauf, hochrangige Regierungsdelegierte mit dem technischen und kommerziellen Know-how zu vernetzen, das Bremens Konferenz so erfolgreich vermittelt.“
Die International Cotton Conference Bremen ist dafür bekannt, Themen wie Baumwollanbau, Qualitätsbewertung, Textilverarbeitung, innovative Baumwollprodukte sowie die vernetzte textile Wertschöpfungskette zu behandeln.
Die Bremer Baumwollbörse, das FIBRE und das ICAC freuen sich darauf, im März 2026 Delegierte aus Regierung, Industrie und Forschung in Bremen zu begrüßen.
International Cotton Conference Bremen International Cotton Advisory Committee ICAC Bremer Baumwollbörse
Bremer Baumwollbörse