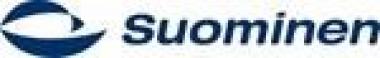MUNICH FABRIC START Exhibitions GmbH mit neuem Führungsteam
Die internationale Fabric Trade Show MUNICH FABRIC START mit den Show-in-Show-Formaten BLUEZONE, KEYHOUSE und THE SOURCE stellt sich mit neuer Führungsspitze auf. Der bisherige Geschäftsführer, Sebastian Klinder, ist zu Mitte März 2025 ausgeschieden.
Als neue Geschäftsführer hat die MUNICH FABRIC START Exhibitions GmbH Peter C. Dumont (54) und Florian Klinder (44) berufen. Peter C. Dumont wird als Marketing- und Vertriebsexperte unter anderem die Internationalisierung sowie Digitalisierung weiterentwickeln. Florian Klinder bringt langjährige Branchenerfahrung als Geschäftsführer der Textilagentur Klinder GmbH und die Nähe zum Markt mit. Er wird sich unter anderem dem Ausbau von Kooperationen widmen. Frank Junker (60) bleibt als Creative Director und Gesellschafter der MUNICH FABRIC START Exhibitions GmbH aktiv und steht mit seiner umfassenden Event- und Messeexpertise weiterhin zur Seite.
Strategische Ausrichtung
In den vergangenen Jahren hat sich die MUNICH FABRIC START zu einer One-Stop-Sourcing-Lösung für europäische Designer, Produktverantwortliche und Modemacher entwickelt. Kooperationen, Internationalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit – das sind die strategischen Themen, auf die das neue Führungsteam für die künftige Ausrichtung der Messe weiterhin setzt.
Als nächstes wird dies auf der kommenden VIEW Premium Selection im Dampfdom Motorworld München zu entdecken sein. Am 1. und 2. Juli 2025 zeigt die VIEW Premium Selection eine sorgfältig kuratierte Kollektionsauswahl namhafter internationaler Premium-Weber und Hersteller von Textilien und Zutaten. Zu sehen sind die neuesten Materialentwicklungen und Kollektionen für Autumn.Winter 26/27. Die Veranstalter rechnen aufgrund der positiven Resonanz mit mehr Ausstellern als im Vorjahr.
Am 2. und 3. September 2025 folgt dann die MUNICH FABRIC START mit über 1.000 Kollektionen mit den Fabric Trends und Materialneuheiten der wichtigsten internationalen Stoff- und Zutatenhersteller für Autumn.Winter 26/27. Zum gleichen Zeitpunkt finden die internationale Denim Trade Show BLUEZONE und der Innovationshub KEYHOUSE statt.
MUNICH FABRIC START Exhibitions GmbH