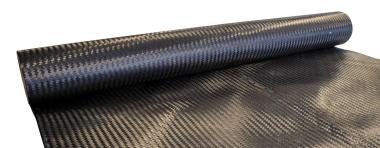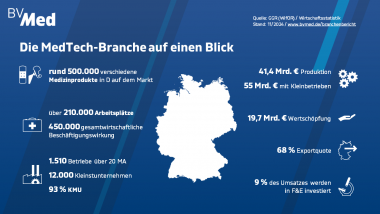Slipeinlagen beugen bakterieller Vaginose vor
Weltweit hat knapp ein Drittel der Frauen in der fruchtbaren Lebensphase eine bakterielle Vaginose. Dabei kommt das empfindliche Mikrobiom der Vagina aus dem Gleichgewicht. Eine solche Störung der Scheidenflora kann Infektionen des Urogenitalbereichs, Abszesse an den Eierstöcken oder Eileitern sowie Frühgeburten auslösen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Unfruchtbarkeit der Frau ist damit deutlich erhöht und das Risiko, sich mit einer Geschlechtskrankheit oder HIV anzustecken, steigt. Die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) haben im Rahmen eines BW Sprint-Projekts die Grundlagen für die Entwicklung einer Slipeinlage geschaffen, die die Gesunderhaltung des vaginalen Milieus unterstützt und einer bakteriellen Vaginose vorbeugen kann.
Das Mikrobiom ist die Gesamtheit aller Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilze auf und im menschlichen Körper. Es ist von zentraler Bedeutung für die Immunabwehr. Wenn das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht geraten ist, können sich Krankheitserreger schneller ausbreiten. Eine Störung der Scheidenflora führt häufig zu einer Reduzierung der im gesunden Mikrobiom vorhandenen Milchsäurebakterien, wodurch weniger Milchsäure (Lactat) freigesetzt wird und der pH-Wert in der Vagina deutlich ansteigt. Das Risiko für eine bakterielle Vaginose ist erhöht.
Derzeit gibt es keine zufriedenstellende Vorbeugung und Therapie bei bakterieller Vaginose. Die leitliniengerechte Behandlung mit Antibiotika führt zu einer Rückfallquote von etwa 50 Prozent. Die betroffenen Frauen sind dadurch körperlich und meist auch psychisch stark belastet.
An den DITF hat ein Forschungsteam die Grundlagen für die Entwicklung einer mit Lactid beladenen Slipeinlage erarbeitet. Lactid ist der zyklische Diester der Milchsäure. Dieser kann auf verschiedene Art und Weise in einen textilen Träger eingebracht werden. Eine effektive Methode ist das Ausspinnen einer Lösung aus Polymer und Wirkstoff zu Fasern. Das Aufbringen einer wirkstoffbeladenen Beschichtung auf ein Zellulosetextil wurde an den DITF ebenfalls getestet. Beim Tragen der Slipeinlage entsteht aus dem freigesetzten Lactid im physiologischen Milieu Milchsäure (Lactat). Der pH-Wert im Scheidenmilieu kann auf ein „gesundes“, leicht saures Niveau gesenkt werden. Dies kann entscheidend zur Vorbeugung beitragen und ein Wiederaufflammen einer bakteriellen Vaginose verhindern.
Die Wirkstofffreisetzung muss die reale Anwendungsdauer von Slipeinlagen berücksichtigen. Dafür musste ein Wirkstoff gefunden werden, der innerhalb weniger Minuten für wenige Stunden temperatur- und feuchtigkeitsgesteuert freigesetzt wird. Eine weitere Anforderung ist, ressourcenschonende und umweltverträgliche Materialien zu verwenden.
In ersten Modellversuchen mit künstlichem Vaginalsekret konnte gezeigt werden, dass es bei Lactid-beladenen Fasern und Lactid-beschichteten Geweben möglich ist, den pH-Wert innerhalb kurzer Zeit von einem „ungesunden“ Wert von über 4,6 auf einen „gesunden“ Wert von 3,8 zu reduzieren.
In weiteren Forschungsvorhaben soll der vielversprechende Weg zu einer präventiv wirksamen Slipeinlage fortgesetzt werden. Dazu soll ein realitätsnahes vaginales Prüfmodell entwickelt werden, um die beladenen Textilwerkstoffe weiter zu optimieren. Die Körper- und Umweltverträglichkeit stehen dabei im Vordergrund.
Damenhygiene Slipeinlagen Vaginose Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf
Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf