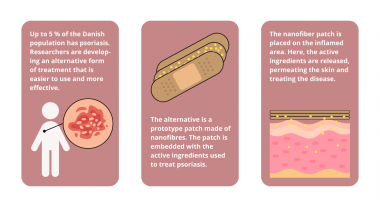MIT-Forschung: Faser-Computer für Bekleidung
MIT-Forscher haben einen Faser-Computer entwickelt und mehrere zu einem Kleidungsstück vernetzt, das lernt, körperliche Aktivitäten zu erkennen.
Was wäre, wenn die Kleidung, die Sie tragen, für Ihre Gesundheit sorgen könnte?
MIT-Forscher haben einen autonomen programmierbaren Computer in Form einer elastischen Faser entwickelt, der den Gesundheitszustand und die körperliche Aktivität überwachen und den Träger in Echtzeit auf mögliche Gesundheitsrisiken hinweisen könnte. Die Kleidung, die den Fasercomputer enthält, ist bequem und maschinenwaschbar, und die Fasern seien für den Träger fast nicht wahrnehmbar, so die Forscher.
Im Gegensatz zu den als „Wearables“ bekannten Überwachungssystemen am Körper, die sich an einem einzigen Punkt wie der Brust, dem Handgelenk oder dem Finger befinden, haben Textilien und Kleidung den Vorteil, dass sie mit großen Bereichen des Körpers in der Nähe der lebenswichtigen Organe in Kontakt sind. Damit bieten sie eine außergewöhnliche Möglichkeit, die menschliche Physiologie und Gesundheit zu messen und zu verstehen.
Der Faser-Computer enthält eine Reihe von Mikrogeräten, darunter Sensoren, einen Mikrocontroller, einen digitalen Speicher, Bluetooth-Module, optische Kommunikation und eine Batterie, die alle notwendigen Komponenten eines Computers in einer einzigen elastischen Faser vereinen.
Die Forscher versahen ein Oberteil und ein Paar Leggings mit vier Fasercomputern, wobei die Fasern entlang der Gliedmaßen verliefen. In ihren Experimenten bediente jeder unabhängig programmierbare Fasercomputer ein maschinelles Lernmodell, das darauf trainiert war, die vom Träger ausgeführten Übungen selbstständig zu erkennen, was zu einer durchschnittlichen Genauigkeit von etwa 70 Prozent führte.
Erstaunlicherweise stieg die kollektive Genauigkeit auf fast 95 Prozent, als die Forscher den einzelnen Faser-Computern erlaubten, untereinander zu kommunizieren.
„Unser Körper sendet jede Sekunde Gigabytes an Daten in Form von Wärme, Schall, Biochemie, elektrischen Impulsen und Licht über die Haut aus, die alle Informationen über unsere Aktivitäten, Gefühle und Gesundheit enthalten. Leider wird das meiste - wenn nicht alles - absorbiert und geht dann in der Kleidung, die wir tragen, verloren. Wäre es nicht fantastisch, wenn wir der Kleidung beibringen könnten, diese wichtigen Informationen zu erfassen, zu analysieren, zu speichern und in Form von wertvollen Erkenntnissen über Gesundheit und Aktivität weiterzugeben?“, sagt Yoel Fink, Professor für Materialwissenschaften und Ingenieurwesen am MIT, leitender Forscher im Research Laboratory of Electronics (RLE) und im Institute for Soldier Nanotechnologies (ISN) und Hauptautor eines Artikels über die Forschung, der in Nature veröffentlicht wurde.
Der Einsatz des Faser-Computers zur Erforschung von Gesundheitszuständen und zur Vorbeugung von Verletzungen wird demnächst auch einem bedeutenden Praxistest unterzogen. Angehörige der US-Armee und der Marine werden eine einmonatige Winterforschungsmission in der Arktis durchführen und dabei 1.000 Kilometer bei Durchschnittstemperaturen von -40 Grad Celsius zurücklegen. Dutzende von Merino-Mesh-Shirts mit Fasercomputern werden Echtzeitinformationen über den Gesundheitszustand und die Aktivität der Teilnehmer an dieser Mission namens Musk Ox II liefern.
„In nicht allzu ferner Zukunft werden wir mit Hilfe von Glasfaser-Computern in der Lage sein, Anwendungen auszuführen und wertvolle Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen von einfacher Alltagskleidung zu erhalten. Wir freuen uns darauf, bei der bevorstehenden Arktis-Mission durch unsere Partner in der US-Armee, der Marine und der DARPA einen Blick in diese Zukunft zu werfen. Es ist eine Ehre und ein Privileg, dazu beizutragen, dass unsere Soldaten in den härtesten Umgebungen sicher sind“, sagt Fink.
Neben ihm arbeiten Nikhil Gupta, ein MIT- Diplomand der Materialwissenschaften und des Ingenieurwesens, Henry Cheung MEng '23, und Syamantak Payra '22, derzeit Diplomand an der Stanford University, John Joannopoulos, Francis Wright Professor für Physik am MIT und Direktor des Instituts für Nanotechnologien von Soldaten, sowie weitere Mitarbeiter des MIT, der Rhode Island School of Design und der Brown University an dem Projekt mit.
Schwerpunkt Fasern
Der Fasercomputer baut auf mehr als zehn Jahre Arbeit im Fibers@MIT-Labor am RLE auf und wurde hauptsächlich vom ISN unterstützt. In früheren Arbeiten haben die Forscher Methoden zur Integration von Halbleiterbauelementen, optischen Dioden, Speichereinheiten, elastischen elektrischen Kontakten und Sensoren in Fasern demonstriert, die zu Stoffen und Bekkleidung verarbeitet werden können.
„Aber wir stießen an eine Grenze, was die Komplexität der Geräte angeht, die wir in die Faser einbauen konnten, bedingt durch die Art, wie wir sie herstellten. Wir mussten den gesamten Prozess neu überdenken. Gleichzeitig wollten wir die Faser elastisch und flexibel machen, damit sie den Eigenschaften herkömmlicher Stoffe entspricht“, sagt Gupta.
Eine der Herausforderungen, die die Forscher zu bewältigen hatten, ist die geometrische Diskrepanz zwischen einer zylindrischen Faser und einem flachen Chip. Die Verbindung von Drähten mit kleinen, leitfähigen Bereichen, den so genannten Pads, an der Außenseite jedes ebenen Mikrobauteils erwies sich als schwierig und störanfällig, da komplexe Mikrobauteile viele Pads haben, so dass es immer schwieriger wird, genügend Platz zu finden, um jeden Draht sicher zu befestigen.
In diesem neuen Design bilden die Forscher die 2D-Pad-Ausrichtung jedes Mikrobauteils auf ein 3D-Layout ab, indem sie eine flexible Leiterplatte, einen so genannten Zwischenschaltkreis, in einen Zylinder einwickeln. Sie nennen dies das „Maki“-Design. Dann befestigten sie vier separate Drähte an den Seiten der „Maki“-Rolle und verbanden alle Komponenten miteinander.
„Dieser Fortschritt war für uns von entscheidender Bedeutung, da wir dadurch in der Lage waren, Computerelemente mit höherer Funktionalität, wie den Mikrocontroller und den Bluetooth-Sensor, in die Faser einzubauen“, sagt Gupta.
Diese flexible Falttechnik könnte bei einer Vielzahl von mikroelektronischen Bauelementen eingesetzt werden und ihnen zusätzliche Funktionen verleihen.
Darüber hinaus stellten die Forscher den neuen Fasercomputer aus einer Art thermoplastischem Elastomer her, das um ein Vielfaches flexibler ist als die bisher verwendeten Thermoplaste. Dieses Material ermöglichte es ihnen, eine maschinenwaschbare, elastische Faser herzustellen, die sich um mehr als 60 Prozent dehnen lässt, ohne zu versagen.
Sie stellen den Fasercomputer mithilfe eines thermischen Ziehverfahrens her, das die Fibers@MIT-Gruppe Anfang der 2000er Jahre entwickelt hat. Bei diesem Verfahren wird eine makroskopische Version des Fasercomputers, eine so genannte Vorform, hergestellt, die jedes angeschlossene Mikrobauteil enthält.
Diese Vorform wird in einen Ofen gehängt, geschmolzen und nach unten gezogen, um eine Faser zu bilden, die auch eingebettete Lithium-Ionen-Batterien enthält, damit sie sich selbst mit Strom versorgen kann.
„Ein früheres Gruppenmitglied, Juliette Marion, hat herausgefunden, wie man elastische Leiter herstellt, so dass diese nicht brechen, selbst wenn man die Faser dehnt. Wir können die Funktionalität beim Dehnen aufrechterhalten, was für Prozesse wie das Stricken, aber auch für Kleidung im Allgemeinen entscheidend ist“, sagt Gupta.
Bringen Sie sich ein
Sobald der Fasercomputer hergestellt ist, ummanteln die Forscher die Faser mit einer Flechttechnik aus herkömmlichen Garnen wie Polyester, Merinowolle, Nylon und sogar Seide.
Zusätzlich zur Erfassung von Daten über den menschlichen Körper mit Hilfe von Sensoren enthält jeder Fasercomputer LEDs und Lichtsensoren, die es mehreren Fasern in einem Kleidungsstück ermöglichen, miteinander zu kommunizieren und ein textiles Netzwerk zu schaffen, das Berechnungen durchführen kann.
Jeder Faser-Computer verfügt außerdem über ein Bluetooth-Kommunikationssystem, um Daten drahtlos an ein Gerät wie ein Smartphone zu senden, das von einem Benutzer ausgelesen werden kann.
Die Forscher nutzten diese Kommunikationssysteme, um ein textiles Netzwerk zu schaffen, indem sie Fasercomputer in ein Kleidungsstück einnähten, einen in jedem Ärmel. Jede Faser führte ein unabhängiges neuronales Netzwerk aus, das darauf trainiert wurde, Übungen wie Kniebeugen, Planken, Armkreisen und Ausfallschritten zu erkennen.
„Wir haben herausgefunden, dass die Fähigkeit eines Faser-Computers, menschliche Aktivitäten zu erkennen, nur zu etwa 70 Prozent genau ist, wenn er sich an einer einzigen Extremität, den Armen oder Beinen, befindet. Wenn wir jedoch die Fasern an allen vier Gliedmaßen „abstimmen“, erreichten sie zusammen eine Genauigkeit von fast 95 Prozent.
Das zeigt, wie wichtig es ist, dass sie sich an mehreren Körperstellen befinden und ein Netzwerk zwischen autonomen Fasercomputern bilden, das keine Drähte und Verbindungen benötigt“, sagt Fink.
In Zukunft wollen die Forscher die Zwischenspeichertechnik nutzen, um weitere Mikrobauteile einzubauen.
Einblicke in die Arktis
Im Februar ist ein multinationales Team, ausgestattet mit Computergeweben, 30 Tage und 1.000 Kilometer in der Arktis unterwegs. Die Gewebe werden für die Sicherheit des Teams sorgen und den Weg für künftige physiologische „digitale Zwillingsmodelle“ ebnen.
„Als Führungskraft mit mehr als zehn Jahren Einsatzerfahrung in der Arktis ist eine meiner größten Sorgen, wie ich mein Team vor schweren Verletzungen durch die Kälte schützen kann - eine der Hauptgefahren für die Einsatzkräfte in der extremen Kälte“, sagt Major Mathew Hefner, der Kommandeur von Musk Ox II. „Herkömmliche Systeme liefern mir einfach kein vollständiges Bild. Wir werden die Computergewebe der Basisschicht rund um die Uhr tragen, um die Reaktion des Körpers auf extreme Kälte besser zu verstehen und letztendlich Verletzungen vorhersagen und verhindern zu können.“
Karl Friedl, leitender Wissenschaftler für Leistungsphysiologie am U.S. Army Research Institute of Environmental Medicine, merkte an, dass die programmierbare Computertechnologie des MIT zu einem „Gamechanger für das tägliche Leben“ werden könnte.
„Stellen Sie sich vor, dass in naher Zukunft Faser-Computer in Textilien und Bekleidung eingesetzt werden, die die Umgebung und den physiologischen Zustand des Einzelnen wahrnehmen und darauf reagieren, den Komfort und die Leistung erhöhen, den Gesundheitszustand in Echtzeit überwachen und Schutz vor äußeren Bedrohungen bieten. Soldaten werden die ersten Anwender und Nutznießer dieser neuen Technologie sein, die mit KI-Systemen integriert ist, die vorausschauende physiologische Modelle und einsatzrelevante Werkzeuge nutzen, um die Überlebensfähigkeit in rauen Umgebungen zu verbessern“, sagt Friedl.
„Die Verbindung von klassischen Fasern und Stoffen mit Computern und maschinellem Lernen hat gerade erst begonnen. Wir erforschen diese spannende Zukunft nicht nur durch Forschung und Feldversuche, sondern vor allem in einem Kurs des MIT Department of Materials Science and Engineering mit dem Titel 'Computing Fabrics', der zusammen mit Professor Anais Missakian von der Rhode Island School of Design unterrichtet wird“, so Fink weiter.
Diese Forschung wurde teilweise vom U.S. Army Research Office Institute for Soldier Nanotechnology (ISN), der U.S. Defense Threat Reduction Agency, der U.S. National Science Foundation, dem Fannie and John Hertz Foundation Fellowship, dem Paul and Daisy Soros Foundation Fellowship for New Americans, dem Stanford-Knight Hennessy Scholars Program und der Astronaut Scholarship Foundation unterstützt.
Adam Zewe | MIT News
KI-gestützte Übersetzung Textination